Reichelsheimer Nachrichten
Meldung vom 11.11.2023
Reichelsheimer Klimabrief: Guter Vorsatz für 2024? Artenschutz zuhause!
Mit dem 'Reichelsheimer Klimabrief' wollen die GRÜNEN Reichelsheim das Bewusstsein für die Erderwärmung und den Klimawandel speziell in der Stadt Reichelsheim stärken und mit interessierten Mitbürgern in die Diskussion gehen. Feedback nehmen die GRÜNEN gerne unter gruene-reichelsheim@web.de entgegen.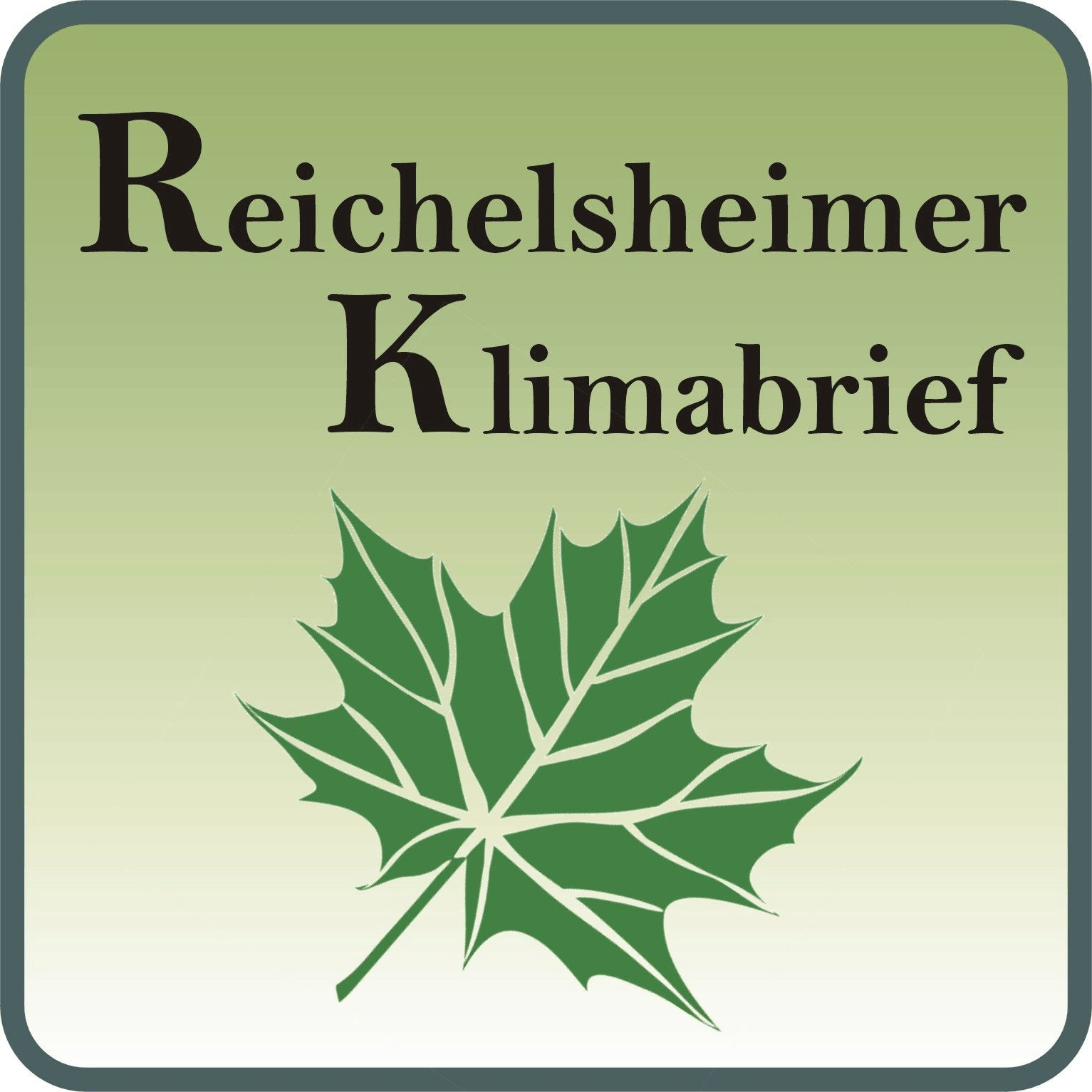
Von Merlin Fleischhauer
Die EU hat eine erschreckende Zahl veröffentlicht: Ein Fünftel aller heimischen Arten soll in wenigen Jahren von unserem Kontinent verschwunden sein. Da ist es doch eigentlich fünf nach zwölf für uns alle, etwas, jeder innerhalb seiner Möglichkeiten, dagegen zu tun, denn das Zusammenspiel der Arten untereinander für den Erhalt des Ökosystems, innerhalb dessen wir als Menschen überleben können, ist in den allermeisten Fällen noch immer unbekannt.Der Verlust der Biodiversität nimmt immer mehr an Fahrt auf. Weltweit gelten etwa 40 Prozent aller Pflanzenarten als vom Aussterben bedroht. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass das sechste Massenaussterben in der Geschichte des Planeten begonnen hat, ausgelöst durch eine einzige Art: den Menschen.
Balkone und Gärten können zum Beispiel Refugien für bedrohte Pflanzenarten sein. Gezieltes Anpflanzen bedrohter Pflanzenarten auf privaten Grundstücken kann helfen, die Biodiversitätskrise in Deutschland und anderswo etwas abzufedern. Die Artenschutz-Methode, bei der jeder und jede mitmachen kann, hat auch schon einen offiziellen Namen: Conservation Gardening.
Knapp die Hälfte aller Pflanzenarten, die in Deutschland als bedroht gelten, sind nicht allzu kompliziert zu pflegen und man kann sie beim Gärtner oder im Internet kaufen.
In einer Studie, die kürzlich im Wissenschaftsjournal Scientific Reports erschienen ist, wurde für jedes einzelne Bundesland untersucht, welche Pflanzen genau durch Conservation Gardening gerettet werden könnten. Dazu wurde analysiert, welche Bedürfnisse die Pflanzen auf den jeweiligen Roten Listen der einzelnen Bundesländer haben und ob man sie kaufen kann.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern sind relativ groß. In Hamburg beispielsweise sind 352 von 670 gefährdeten Arten geeignet, in Bayern sind der Untersuchung zufolge dagegen nur 321 von 1123 Pflanzenarten auf der Roten Liste geeignet. Diese sind teilweise für sehr kleine Eurobeträge zu kaufen und leicht zu pflegen. Im National Geographic veröffentlicht, gibt es auch eine App der Uni Leipzig hierzu.
Conservation Gardening könnte sozusagen aus der Not eine Tugend machen und die sonst fast immer schädliche Omnipräsenz des Menschen nutzen, um gefährdeten Spezies zu helfen. Vielen der bedrohten Pflanzen ist nämlich gemein, dass sie in der Natur keine Chance haben, weil sie von anderen Arten, die besser mit der Überdüngung und Schädigung der Böden zurechtkommen, überwuchert und verdrängt werden. Im Garten und auf dem Balkon könnten Menschen darauf achten, dass das nicht passiert.
Allein in Deutschland gibt es etwa 17 Millionen Privatgärten, die genaue Fläche ist nicht bekannt, aber sie ist riesig. Wenn Menschen nur auf einem Bruchteil davon bedrohte Pflanzen hegen und pflegen würden, könnte das durchaus einen messbaren Effekt haben.
Wie viele der 17 Millionen Privatgärten in Deutschland naturnah sind, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass immer mehr Menschen auf ihrem Grundstück Insekten, Vögeln und anderen Tieren helfen und etwas gegen den Schwund der Biodiversität unternehmen wollen.
Je mehr verschiedene Lebensräume es im Garten gibt, desto mehr Arten werden sich dort einfinden. In einer Hecke fühlen sich andere Tiere wohl als etwa auf einer Blumenwiese. Weitere Lebensräume, die sich auch auf kleiner Fläche realisieren lassen, sind zum Beispiel Totholzhaufen, eine wilde Ecke, in der auch Brennnesseln wachsen dürfen, sandige Stellen und natürlich Wasser. Man kann auch auf kleiner Fläche erstaunlich viel erreichen, die Natur reagiert verblüffend schnell. Am schnellsten bemerkt man die Veränderung in der Regel an den Insekten. Wer zum Beispiel seinen Rasen weniger mäht, wird vermutlich bald Heuschrecken im Garten haben, die hohe Grasstrukturen brauchen. Und wer eine Blumenwiese wachsen lässt, in der vielleicht der Natternkopf blüht, der wegen des hohen Zuckergehalts seines Nektars bei Bienen beliebt ist, kann oft schon im ersten Jahr verschiedene Wildbienen-Arten beim Nektarsammeln beobachten.
Natürlich können Naturnahe Gärten keine Schutzgebiete ersetzen, viele Tiere und Pflanzen benötigen größere Flächen, und da stößt der schönste naturnahe Garten an seine Grenzen. Es ist toll, einen Baum zu haben, aber wer hat schon einen Wald im Garten? Das ist ein ganz anderes Ökosystem.
Naturnahe Gärten helfen vor allem Allerweltsarten, wie zum Beispiel dem Feldsperling. Diese wurden im Naturschutz lange Zeit unterschätzt. Doch mittlerweile ist klar, dass es für den Artenschutz auch sehr wichtig ist, häufigen Arten Lebensraum zu bieten. Von einer ganzen Schar Feldsperlinge im Garten können dann zum Beispiel wieder seltenere Greifvögel profitieren, die sozusagen im Vorbeifliegen einen Spatz erbeuten. Hochbedrohte Arten kommen in Gärten nur dann vor, wenn sie einen geringen Flächenbedarf haben. Ein Beispiel ist die sehr seltene Mohnmauerbiene, die Blütenblätter von Klatschmohn ausschneidet und damit ihre Bruthöhle auskleidet.
Worauf muss am also achten, wenn man seinen Garten naturnah gestalten will? Wichtig ist, erst einmal zu schauen, was da ist. Es wäre zum Beispiel nicht ratsam, einen schönen alten Bauerngarten plattzumachen, um dort eine artenreiche Magerwiese anzulegen. Wer einen Garten in Hanglage hat, wird dort nie erfolgreich eine Feuchtwiese anlegen können. Genauso aussichtslos ist es, eine Blumenwiese in einem Garten zu säen, der den ganzen Tag im Schatten liegt. Oft sind es Kleinigkeiten, die einen Garten naturnäher machen, etwa verblühte Pflanzen jetzt im Herbst nicht abzuschneiden, sondern über den Winter stehen zu lassen. In den Stängeln können dann zum Beispiel Insekten überwintern. Anders gesagt: Oft ist schon viel getan, indem man nichts tut. Wer zum Beispiel seinen Rasen einfach mal wachsen lässt, wird oft überrascht sein, wie viele Blumen dort plötzlich auftauchen.
Immer eine gute Idee ist es, einen Teich anzulegen. Wasser ist ein Magnet für viele verschiedene Spezies. Sinnvoll ist es auch, einen Baum zu pflanzen. Davon profitieren viele verschiedene Arten gleichzeitig. Man sollte sich allerdings vorher überlegen, wie groß der Baum wird. Eichen zum Beispiel ziehen zwar ähnlich wie ein Teich viele Arten an, können aber viel größer werden als andere Bäume. Eine gute Alternative könnte ein Obstbaum sein. Wer einen naturnahen Garten neu anlegen will, braucht aber auch Geduld. Die Natur funktioniert nicht nach dem Schema, wenn ich A mache, passiert B. Um zum Beispiel den Kreuzenzian-Bläuling anzulocken, einen deutschlandweit stark gefährdeten blauen Schmetterling, reicht es nicht, einen Magerrasen anzulegen, in dem Kreuzenzian wächst. Zusätzlich muss im Garten eine ganz bestimmte Ameisenart vorkommen, deren Geruch die Schmetterlingslarven imitieren, damit sie ins Ameisennest getragen und dort den Winter über gefüttert werden.
Das Umfeld ist ebenfalls extrem wichtig. Ein einzelner naturnaher Garten, der von einer Betonwüste umgeben ist, ist zwar besser als kein Garten, bringt für den Artenschutz aber relativ wenig. Die meisten Tiere können in einen solchen Garten gar nicht einwandern, sie gehen oder fliegen eben nicht über Schnellstraßen zum Beispiel. Am artenreichsten sind naturnahe Gärten, die in der Nähe einer größeren naturnahen Fläche liegen, Wald oder Naturschutzgebiet etwa. Grundsätzlich gilt: Je mehr naturnahe Flächen es in der Umgebung gibt, desto größer ist der positive Effekt. Idealerweise entsteht so ein Netz, dass Tiere und Pflanzen nutzen können, um sich von einem Ort zum anderen zu hangeln. Eine zentrale Bedeutung von Gärten für den Artenschutz liegt darin, dass sie als Trittsteine fungieren und Habitate miteinander vernetzen. Zum Beispiel können Eichelhäher, die in Wäldern brüten, sich sonst aber auch gerne in offenerem Gelände aufhalten, Gärten nutzen, um von einem in den anderen Lebensraum zu gelangen. Grundsätzlich sind Tier- und Pflanzenpopulationen robuster, wenn sie nicht isoliert sind.
Was hat man selbst von einem naturnahen Garten? Gärten sind für Menschen da, und das soll sich auch nicht ändern. Gärten sind keine Naturschutzgebiete, sie sollen für die Augen und für die Seele des Menschen schön sein und der Erholung dienen. Diese Funktion mit dem Artenschutz zu vereinbaren, ist aber machbar. Wer ein kleines Kind hat, das ständig barfuß läuft, muss natürlich öfter mähen, als jemand mit Mitte 50, der möglichst wenig Arbeit mit dem Garten haben will und für den dann vielleicht eine Blumenwiese das Richtige ist. In allen Fällen erfüllen naturnahe Gärten eine Funktion, die mindestens genauso wichtig ist wie der größere Artenreichtum im Vergleich zu Gärten mit Rollrasen oder gar Schotter: Sie fördern das Verständnis für die Kreisläufe und die Zusammenhänge in der Natur, was wiederum aber mit dem Naturbedürfnis des Menschen und daraus inhärent folgender tieferer Erholung zusammenhängt. Das kann die Entdeckung sein, dass die lästigen Blattläuse plötzlich verschwunden sind und stattdessen viele Marienkäfer im Garten leben, die Blattläuse fressen. Oder die Erfahrung, dass Vögel ins mühsam gebaute und endlich bewohnte Insektenhotel picken. Wer bis hierher gelesen hat, ahnt es schon: Man sollte das nicht verhindern. Es ist vollkommen in Ordnung.
Links zum Thema:
- More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas | PLOS ONE
- Artenschutz im eigenen Garten: So kann man bedrohte Pflanzen retten | National Geographic
Text: Merlin Fleischhauer, Grüne Reichelsheim vom 11.11.2023