Reichelsheimer Nachrichten
Meldung vom 24.07.2023
Reichelsheimer Klimabrief: Hecken und Feldgehölze sind wichtige Bestandteile unserer Kulturlandschaft
Mit dem 'Reichelsheimer Klimabrief' wollen die GRÜNEN Reichelsheim das Bewusstsein für die Erderwärmung und den Klimawandel speziell in der Stadt Reichelsheim stärken und mit interessierten Mitbürgern in die Diskussion gehen. Feedback nehmen die GRÜNEN gerne unter gruene-reichelsheim@web.de entgegen.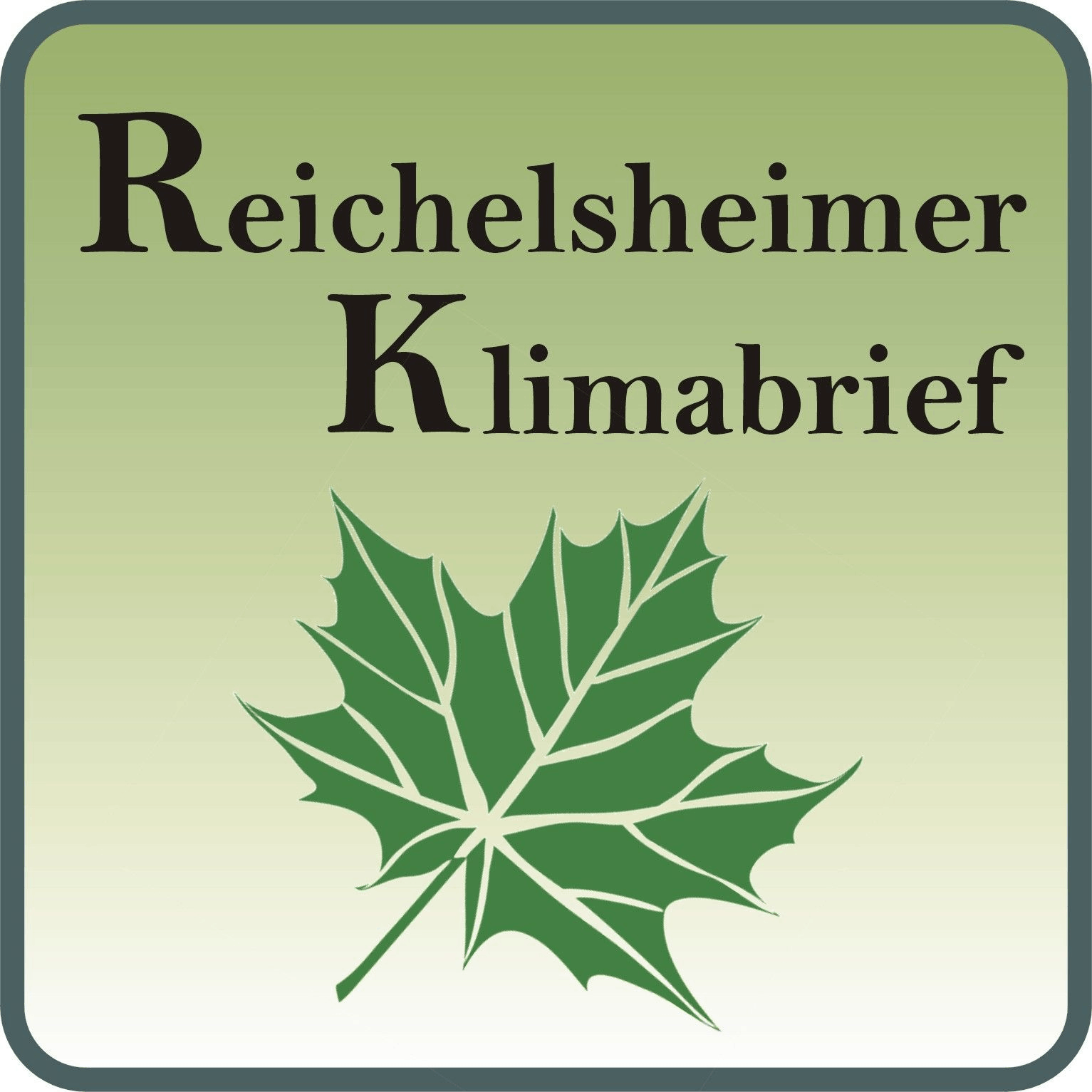
Von Merlin Fleischhauer
Hecken und Feldgehölze mit ihren vielfältigen Säumen sind wichtige Bestandteile unserer Kulturlandschaft und erfüllen zahlreiche agrarökologische Funktionen. Die Gehölzstrukturen verhindern Bodenerosion, bieten Windschutz und vermindern Stoffeinträge in benachbarte Flächen und Gewässer. Für die Fauna sind sie wichtiges Nahrungsbiotop, Brut- und Aufzuchtplatz, Ruhestätte und Winterquartier in der halboffenen Landschaft. Zusammen mit ihren Säumen sind Hecken und Feldgehölze als Strukturelemente in unserer Landschaft für die Vernetzung von Lebensräumen und als Naturkorridore unverzichtbar.Artenvielfalt geht uns alle an, denn die landwirtschaftlich genutzten Lebensräume spielen eine wichtige Rolle für die Biodiversität in Mitteleuropa. Allein in Deutschland werden über 50 Prozent der Landesfläche für landwirtschaftliche Zwecke genutzt und prägen somit maßgeblich den Lebensraum von Tieren und Pflanzen und letztlich auch uns Menschen. Allerdings ist gerade hier der Artenrückgang aufgrund der kontinuierlichen Intensivierung der Landnutzung besonders dramatisch. Dies betrifft selbst Tiere und Pflanzen, die früher mal typische Begleiter von Äckern und Wiesen waren, so wie Feldlerche oder Braunkehlchen. Heute sieht das Bild aber schon ganz anders aus: Blütenreiche und mit Leben erfüllte Wiesen sind heutzutage kaum noch zu entdecken.
Auch Ackerwildkräuter, wie der Sandmohn oder der Ackerrittersporn, die früher für eine bunte Vielfalt auf den Feldern sorgten, werden immer seltener. Hier sind Hecken und Gehölzgruppen besonders wichtig, denn Gehölzstrukturen und Säume verhindern Einträge von Dünge- und Spritzmitteln auf angrenzende Flächen. Diese wertvollen Strukturen schützen besonders Gewässer vor Windeintrag von Bodenverwehungen und somit Eutrophierung durch zu viele Nährstoffe. Sie tragen zur Verbesserung der Gewässerqualität und Förderung der Artenvielfalt bei, indem die Wurzeln Ackerränder festigen, ebenso Hang- und Uferbereiche, sie verhindern bzw. verringern die Bodenerosion und halten die Feuchtigkeit im Boden. Gehölzstrukturen bremsen außerdem die Windgeschwindigkeit und verringern den Abtrag von wertvollem Boden, welcher dann letztlich wieder in umliegende Gewässer eingetragen wird und deren Qualität durch Eutrophierung beeinträchtigt.
Bedauerlicherweise gibt es in Reichelsheim nur sehr selten Hecken und Gehölzstrukturen in der intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft zu sehen. Dies ist ein Nachteil sowohl für die Landwirte, sowohl als auch für alle anderen Reichelsheimer.
Fehlende Hecken und Gehölze schaden besonders, wenn der Ackerboden entgegen der guten fachlichen Praxis monatelang brach und der wichtige Boden ungeschützt liegt. Wichtige Tatsachen, die bei den zahlreich durchgeführten Flurbereinigungen der letzten Jahrzehnte nicht beachtet wurden, da man nur daran dachte immer mehr Fläche für immer größere Maschinen zur Bearbeitung zu schaffen und die Konsequenzen vernachlässigt hat. Blühstreifen sind leider teilweise ein Feigenblatt, denn meistens werden sie zum Winter samt Insekteneiern umgepflügt und bestehen meistens eben auch nur aus industriell verkauftem „Tütenmix“ mit dem immer gleichen Inhalt.
Weitere Vorteile von Feldrandbewuchs sind des Bodens, Schatten für Pflanze und Tier, Heimstatt für Tag- und Nachtbestäuber und Schädlingsräuber, also Feldvögel und Insekten die etwa pflanzenbefallende Insekten fressen und ein natürliches Gleichgewicht bewahren helfen, so dass ein Übermaß einer einzigen Art verhindert wird.
Traurigerweise werden diese wichtigen und schönen Teile unserer Kulturlandschaft selten erhalten und gepflegt im Wortsinne. In den allermeisten Fällen fährt einfach ein Häcksler durch und macht eben alles „kurz und klein“. Diese Vorgehensweise unterbindet das Wachstum der bereits dort im Boden befindlichen Sprösslinge und verhindert das Wachsen eben bereits in der Hecke befindlicher Bäume und Sträucher. Viele Bäume müssten nicht gepflanzt und mühsam gewässert werden (wenn das denn jemand machte…), würde man ihnen einfach erlauben, an ihrem bereits etablierten Sprossort zu wachsen.
Feldgehölze müssen schonend zurückgeschnitten werden, unter Erhalt der nachkommenden Sprösslinge, allein dadurch könnten zahlreiche Bäume und Sträucher wachsen, die weder gepflanzt noch gewässert werden müssen, weil sie sich eben im Schutz der umliegenden Hecke befinden. Diese einfache und kostensparende Maßnahme wird ignoriert, warum?
Mehr Hecken bieten die Möglichkeit mehr Ertrag durch mehr Bestäuber zu erreichen und weniger Geld für Gift aufwenden zu müssen. Dazu kommt die Bodengesundheit, ohne die bei den heutig ausgelaugten Böden auch das, was dort noch wächst, nähstoffärmer und in immer weiter abnehmender Qualität auf den Tisch oder ins Viehfutter kommt.
Aber es gibt Möglichkeiten, landwirtschaftliche Flächen so zu bewirtschaften, dass sie Lebensraum für wildlebende Tier- und Pflanzenarten bieten. Insbesondere der Ökologische Landbau leistet nachweislich einen hohen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität u.a. aufgrund vielfältiger Fruchtfolgen und des Verzichts auf chemisch-synthetische Pestizide und mineralische Stickstoffdünger. Auch seltene Arten sind, zumindest in geringer Dichte, noch vorhanden. Neu geschaffene Biotope und Landschaftsstrukturen wie Hecken und Säume werden gut besiedelt und schon geringe Änderungen in den Bewirtschaftungsverfahren können eine hohe Wirkung entfalten.
Die Zahl der Vögel in Europa hat in knapp 40 Jahren um ein Viertel abgenommen. Hauptursache dafür ist die intensive Landwirtschaft. Das belegt eine Studie, in der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Bestandsentwicklung von 170 Vogelarten in 28 europäischen Ländern über einen Zeitraum von 37 Jahren analysiert haben.
Für die Untersuchung, die im Wissenschaftsjournal PNAS erschienen ist, wurden mit Hilfe neuer statistischer Methoden der Einfluss verschiedener menschlicher Faktoren untersucht, die unter Verdacht stehen, für das Vogelsterben in Europa verantwortlich zu sein. Neben der intensiven Landwirtschaft untersuchten sie auch die Rolle der Verstädterung und des Klimawandels. Es gibt klare Hinweise darauf, dass die intensive landwirtschaftliche Nutzung, der intensive Gebrauch von Pestiziden und Düngemitteln ein Hauptfaktor ist, der zum Rückgang der Vogelpopulationen führt.
Die intensive Landwirtschaft schadet den Vögeln durch eine Reihe negativer Einflüsse: Der Einsatz von Pestiziden etwa dezimiert die Zahl der Insekten, auf die viele Vogelarten als Nahrung angewiesen sind. Sogar Arten, die als Erwachsene etwas anderes fressen, füttern zumindest ihre Jungen mit den proteinreichen Kerbtieren. Der Insektenschwund führt deshalb dazu, dass ein Teil der Brut schlicht verhungert, weil die Vogeleltern nicht genügend Nahrung finden, um alle durchzufüttern.
Die starke Düngung wiederum lässt Gras und Getreide innerhalb kürzester Zeit in die Höhe schießen. Die Vögel sitzen dadurch mit ihrer Brut im Dunkeln, was für viele Arten ein Problem ist. Der dichte Bewuchs der Ackerflächen verschärft zudem den Mangel an Insektenfutter, weil die Vögel an ihre Nahrung etwa in einem dichten Maisfeld gar nicht mehr herankommen.
Den schädlichen Einfluss der intensiven Landwirtschaft auf die Vögel in Europa belegt die Untersuchung auch indirekt durch einen Ländervergleich. Die Ergebnisse zeigten, dass in Ländern, in denen die intensive Landwirtschaft dominiert, die Vogelbestände besonders stark zurückgehen - vor allem in den westeuropäischen Industriestaaten. Die Ausbreitung von Städten und die Zersiedelung der Landschaft haben der Studie zufolge ebenfalls einen negativen Effekt auf die Zahl der Vögel in Europa - allerdings in einem deutlich geringeren Ausmaß als die intensive Landwirtschaft.
Schöne Beispiele gibt es in Südfrankreich, wo es bekanntlich mangels Regen bereits Trinkwasserprobleme für die Bevölkerung gibt. Dort entdecken Landwirte den Agroforst wieder neu, eine Bewirtschaftungsform, wie sie früher üblich war. Zwischen den Äckern werden Bäume gepflanzt, die ihrerseits Früchte, Nüsse und Holz liefern und gleichzeitig die Ackerböden feucht halten helfen, ohne Bewässerung, sie beschatten und vor Erosion schützen. Es gibt also Hoffnung, man muss nur wollen, denn vielleicht am schmerzhaftesten ist, dass Vogeldiversität im Zusammenhang mit unserer psychischen Gesundheit und unserem Wohlbefinden steht, sagen Wissenschaftler. Der Rückgang der Vögel führt möglicherweise dazu, dass wir trauriger und unglücklicher werden.
Quellenangaben:
- Farmland practices are driving bird population decline across Europe | PNAS
- 'Reservoirs of life': how hedgerows can help the UK reach net zero in 2050 | Environment | The Guardian
- Improving soil could keep world within 1.5C heating target, research suggests | Farming | The Guardian
- Farmers urge UK government to fund hedge creation to bol
Text: Merlin Fleischhauer, Grüne Reichelsheim vom 24.07.2023